Hamburger Sternwarte
Gebäude & Teleskope - Äquatoreal
![(5.5 kB Das Äquatorial (heute) [39 kB])](aequatorial_small.jpg) Das Äquatoreal ist das älteste noch in Bergedorf aufgestellte Fernrohr.
Es handelt sich um einen Refraktor von 26cm Öffnung und 3 m
Brennweite.
Das Äquatoreal ist das älteste noch in Bergedorf aufgestellte Fernrohr.
Es handelt sich um einen Refraktor von 26cm Öffnung und 3 m
Brennweite.
Der Begriff ,,Äquatoreal`` (auch ,,Äquatorial``) wird in
zweifacher Bedeutung verwendet. Im weiteren Sinne (sowie allgemein im
englischen und französischen Sprachgebrauch) bezeichnet Äquatoreal einen
parallaktisch (= im Äquatorsystem beweglich) montierten Refraktor.
Diese Bezeichnung entstand Ende des 18. Jahrhundertes mit den ersten
parallaktisch montierten Fernrohren, um sie von den damals
gebräuchlicheren, im Azimutsystem montierten Fernrohren (Meridiankreise,
Vertikalkreise, Passageinstrumente etc.) unterscheiden zu können. Im
engeren Sinne ist ein Äquatoreal ein parallaktisch montiertes Fernrohr,
das mit großen, fein geteilten Kreisen und Ablesemikroskopen versehen
ist, um auch außerhalb des Meridians direkte Positionsbestimmungen
durch Messung von Rektaszensions- (bzw. Stundenwinkel-) und
Deklinationsdifferenzen vornehmen zu können. Das Hamburger Äquatoreal
ist das größte je gebaute Teleskop dieser Art. Allerdings blieb die
Genauigkeit der Positionsbestimmung stets erheblich hinter derjenigen von
Meridianbeobachtungen zurück, so daß die instrumentelle Entwicklung hier
in eine Sackgasse lief.
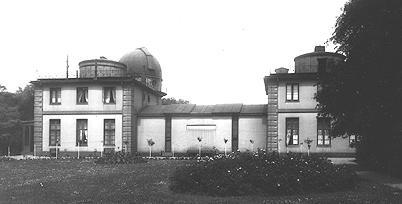 Das Hamburger Äquatoreal wurde 1867 von der Hamburger Firma A. Repsold &
Söhne fertiggestellt und in einem bereits 1855 errichteten Turm mit
eiserner Kuppel an der Nordseite des alten Sternwartengebäudes am
Millerntor aufgestellt. Das zweilinsige Objektiv stammt von der Münchner
Firma G. und S. Merz. 1870 wurde ein zweites Objektiv von dem Hamburger
Optiker Hugo Schröder für dieses Instrument geschliffen, das sich aber
als weniger gut erwies als das Merzsche Objektiv.
Das Hamburger Äquatoreal wurde 1867 von der Hamburger Firma A. Repsold &
Söhne fertiggestellt und in einem bereits 1855 errichteten Turm mit
eiserner Kuppel an der Nordseite des alten Sternwartengebäudes am
Millerntor aufgestellt. Das zweilinsige Objektiv stammt von der Münchner
Firma G. und S. Merz. 1870 wurde ein zweites Objektiv von dem Hamburger
Optiker Hugo Schröder für dieses Instrument geschliffen, das sich aber
als weniger gut erwies als das Merzsche Objektiv.
In seiner Zeit am Millerntor wurde das Äquatoreal hauptsächlich
für visuelle Beobachtungen von Kometen und Kleinplaneten
eingesetzt. Aber auch umfangreiche Programme zur Positionsbestimmung
der ,,Nebelflecke`` wurden mit dem Instrument durchgeführt,
ohne daß man wohl damals wußte, welcher Natur diese Objekte waren.
Im Mai 1908 wurde das Instrument demontiert und nach gründlicher
Überholung durch die Fa. Repsold im Juni 1909 am neuen Standort in
Bergedorf wieder aufgestellt. Hierzu wurde ein eigenes neues
Beobachtungsgebäude im Südosten des Sternwartengeländes errichtet. Die
alte Kuppel von 6m Durchmesser konnte hingegen wiederverwendet werden,
lediglich der Spaltverschluß mit Klappen wurde durch einen Spaltschieber
ersetzt. Zur leichteren Bedienbarkeit befindet sich in der Kuppel ein
hölzerner Beobachtungsstuhl, mit dem sich der Beobachter mittels
Seilzügen um das Teleskop herum sowie auf und nieder bewegen kann, ohne
aufstehen zu müssen. Nachdem auch die anderen Instrumente betriebsbereit waren, versuchte man festzustellen, ob das Aequatoreal sich auch für absolute Positionsbestimmungen eignen würde, diese Versuche verliefen aber im wesentlichen ergebnislos, so daß weiterhin nur relative
Messungen durchgeführt wurden.
![(4.4 kB Das Gebäude des Äquatorials (heute) [41 kB])](aequ_geb_small.jpg) In den ersten Jahren in Bergedorf wurde das Äquatoreal zunächst von K.
Graff vielfältig für visuelle Beobachtungen von Planeten, Kometen und
veränderlichen Sternen eingesetzt. Nach dem ersten Weltkrieg, als die
neuen größeren Teleskope in Bergedorf sämtlich in Betrieb standen,
wurde es jedoch recht still um das Instrument. In den Jahresberichten der
zwanziger und dreißiger Jahre taucht es nur sporadisch auf.
In den ersten Jahren in Bergedorf wurde das Äquatoreal zunächst von K.
Graff vielfältig für visuelle Beobachtungen von Planeten, Kometen und
veränderlichen Sternen eingesetzt. Nach dem ersten Weltkrieg, als die
neuen größeren Teleskope in Bergedorf sämtlich in Betrieb standen,
wurde es jedoch recht still um das Instrument. In den Jahresberichten der
zwanziger und dreißiger Jahre taucht es nur sporadisch auf.
Eine späte Blüte erlangte das Äquatoreal jedoch nach dem zweiten
Weltkrieg in den Händen des passionierten Liebhaberastronomen
Max Beyer.
Von 1946 bis 1977 beobachtete Beyer in fast jeder klaren Nacht Kometen und
veränderliche Sterne. Seine visuellen Beobachtungsreihen sind ein
Musterbeispiel an Gleichmäßigkeit und Sorgfalt, sie wurden regelmäßig
in den ,,Astronomischen Nachrichten" publiziert. Bis in die
jüngste Vergangenheit galt Beyer als der Beobachter mit der weltweit
größten Zahl von visuellen Kometenschätzungen. Daneben diente das
Äquatoreal gelegentlich für öffentliche Führungen.
Nach jahrelangem ,,Dornröschenschlaf" und entsprechendem Verfall wurde
das Gebäude des Äquatorials zwischen Mai 2004 und November 2005 auf
Initiative des Fördervereins
restauriert und mit der Originalfarbgebung
versehen. Die Mittel hierzu kamen von der Hamburger Stiftung
Denkmalpflege, der Bergedorf-Stiftung, vom Förderverein selbst und von
einer Reihe von Einzelspenden.
Das Teleskop ist noch nicht restauriert aber betriebsfähig. Es ist
beabsichtigt, das Äquatorial künftig wieder für öffentliche
Beobachtungen zu nutzen, doch ist hierzu noch ein Rückschnitt der das
Kuppelgebäude umgebenden Vegetation erforderlich.
Text und Bilder von Matthias Hünsch
Postscript Version
|